13/02/2025 0 Kommentare
Der kleine Grieche
Der kleine Grieche
# Neuigkeiten

Der kleine Grieche
Nicht nur durch sein Wirken als Humanist und durch seine außerordentliche Begabung für die griechische, lateinische und hebräische Sprache hebt sich Melanchthon von seinen Zeitgenossen ab.
Auch seine herausragenden Leistungen als Reformator, Politiker und Pädagoge haben entscheidend dazu beigetragen.
Ein Blick auf den Lebenslauf mag dies illustrieren.
Am 16. Februar 1497 erblickte Philipp Schwarzerdt (griechisch: Melanchthon), als erstes von fünf Kindern (1499 Anna, 1500 o. 1501 Georg, 1506 Margarete und 1508 Barbara), im Hause seiner Großeltern in der kurpfälzischen Amtsstadt Bretten das Licht der Welt. Melanchthon wurde zu Ehren des Landesherren Philipp genannt.
Der Vater Melanchthons, Georg Schwarzerdt, der eigentlich in Heidelberg geboren wurde, war ein Meister der Geschützgießerei sowie des Plattnerhandwerks, der Kunst möglichst leichte, aber dennoch feste Rüstungen zu schmieden. Aufgrund seiner Qualifikationen wurde Georg Schwarzerdt in das Amt des kurfürstlichen Rüstmeisters erhoben und war somit an die Stadt Heidelberg gebunden. Melanchthons Mutter hingegen stammte aus der wohlhabenden Kaufmannsfamilie Reuter. Melanchthons Großvater sorgte für eine gründliche Ausbildung (Anstellung des Hauslehrers Johannes Unger für Melanchthon, Georg und zwei Enkelsöhne der Familie Reuter), vor allem in der lateinischen Sprache. Als Melanchthons Vater sowie sein Großvater starben, war für den Elfjährigen die Kindheit beendet.
Philipp wurde durch den Hauslehrer auf die folgende Lateinschule in Pforzheim vorbereitet. In seiner Klasse war er mit Abstand der Beste und bekam vom Rektor Georg Simler sowie dem Kollegen Johannes Hiltebrant die Möglichkeit, die griechische Sprache zu erlernen. Am 15. März 1509 verlieh ihm Reuchlin den Humanistennamen Melanchthon. Er soll gesagt haben:
„Schwarzerdt heißt du, ein Grieche bist du, griechisch soll auch dein Name lauten und so nenne ich dich Melanchthon, das ist so viel wie schwarze Erde."
Die guten Beziehungen Reuchlins zu den Gelehrten der Heidelberger Universität verhalfen Melanchthon dazu, mit zwölfeinhalb Jahren die Universität zu besuchen. Während dieser Studienzeit lebte Philipp bei dem Theologen Pallas Spangel, und beendete sein Studium zum frühest möglichen Zeitpunkt (10. Juni 1511) mit dem Erwerb des Grades des Baccalaureus artium. Als er 1512 zum Magister promovieren wollte, verweigerten die Professoren ihm die Zulassung, da diese nicht glaubten, dass der schmächtige Fünfzehnjährige die Autorität eines akademischen Lehrers besitzen würde.
Mit 17 Jahren (Januar 1514) konnte er, nach Fortsetzung seines Studiums in Tübingen, an der philosophischen Fakultät seine Magisterprüfung ablegen. Dem folgte eine intensive Lehrtätigkeit an der Universität. Die Abfassung erster bedeutender - humanistisch geprägter - Schriften fällt in diese Zeit.
Als Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen für den neu errichteten Lehrstuhl für griechische Literatur an seiner 1502 gegründeten Wittenberger Universität einen Professor suchte, wurde ihm der einundzwanzigjährige Melanchthon von Reuchlin empfohlen. Am 28. August 1518 hielt Melanchthon seine begeisternde Antrittsrede „Über die Umgestaltung des Jugendunterrichts" und studierte außerdem unter Luther Theologie. Schon am 19. September 1519 erlangte er den ersten theologischen Grad (baccalaureus biblicus).
Seine Vorlesungen wurden mit Begeisterung von den Studenten aufgenommen und sogar Luther, der Melanchthons griechische Vorlesungen besuchte, äußerte sich wie folgt:
„Ich danke es meinem guten Philipp, dass er uns griechisch lehrt. Ich bin älter als er. Allein das hindert mich nicht, von ihm zu lernen. Ich sage es frei heraus, er versteht mehr als ich, dessen ich mich auch gar nicht schäme. Darum ich auch gar viel vom dem jungen Mann halte und werde nichts auf ihn kommen lassen."
Die Freundschaft des 14 Jahre jüngeren Melanchthons mit Luther wurde hiermit besiegelt und blieb bis zu Luthers Tod erhalten.
Von 1519 an befasste er sich bis zu seinem Lebensende mit dem Evangelium und der reformatorischen Theologie und konnte Luther schon bei der Disputation zu Leipzig manch gutes Wort zuflüstern - im Zorn soll Dr. Eck einmal ausgerufen haben:
„Schweige Philipp, kümmere dich um deine Studien und störe mich nicht." Auch Luther musste dem sich immer mehr auf die Heilige Schrift stützenden Griechen eingestehen:
„Dieser kleine Grieche übertrifft mich auch in der Theologie."
Weil man den jungen Melanchthon in Wittenberg festhalten wollte, riet man ihm, sich zu vermählen. Er äußerte sich nur mit folgenden Worten:
„Man bittet mich, mich zu vermählen und hält das für eine Verbesserung meiner Umstände. Wüsste ich, dass ich dadurch nicht in meinen Arbeiten und beim Studieren gestört würde, so könnte ich mich leicht dazu entscheiden. Vor der Hand aber wird es unterbleiben." Doch diese Überzeugung bestand nicht lange, denn schon am 25. November 1520 heiratete er die Tochter des Wittenberger Bürgermeisters Hieronymus Krapp, Katharina Krapp.
Als Luther aus Sicherheitsgründen auf die Wartburg gebracht wurde, übernahm Melanchthon Luthers Vorlesungen über biblische Schriften an der Universität.
Durch die Bildungsreform 1525, die der neue Kurfürst Johann der Beständige durchsetzte, war Melanchthon von seiner Professur befreit und konnte Vorlesungen zu jeder Thematik halten.
Gestützt auf seine Vorlesungen zu ethischen und politischen Schriften des Aristoteles und Ciceros, die 1529 bis 1532 veröffentlicht wurden, publizierte er ab 1538 sein eigenes System der Ethik bzw. seit 1550 dessen verbesserte Fassung. 1540 veröffentlichte Melanchthon den ersten Teil seiner Lehre vom Menschen (De anima, endgültige Fassung 1553) und wenig später 1549 sein physikalisches Werk, in dem er sich auch zu dem gerade veröffentlichten kopernikanischen Weltbild äußerte. Neben der Vielzahl seiner Werke kommentierte er auch neutestamentische Schriften. So publizierte er 1527 seinen Kommentar zum Kolosserbrief sowie 1529 bis 1556 den zum Römerbrief (1529 kurze Einführung, 1532 erster vollständiger Kommentar, 1540 sowie 1556 Ersetzung durch Neubearbeitungen).
Auch in der Universitätsverwaltung war er engagiert, 1523/24 bzw. 1538 bekleidete er das Amt des Rektors und 1535/36 bzw. 1546 - 1548 das Amt des Dekans der philosophischen Fakultät.
Seit 1555 hielt Melanchthon in Wittenberg Lesungen über die Weltgeschichte. Das dazu entstandene Werk veröffentlichte er aber unter dem Namen des Berliner Hofastrologen Johann Carion.
Mitte August 1557 reiste Melanchthon auf Befehl des Kurfürsten August zum Wormser Religionsgespräch. Am 27. Oktober 1557 erfuhr Melanchthon vom Tode seiner Frau (13. Oktober 1557), musste jedoch bis Mitte Dezember 1557 in Worms verharren.
Mittlerweile war aus Melanchthon ein alter, kränkelnder und von vielen Seiten angefochtener Mann geworden. Seit dem Tod seiner Frau verschlechterte sich Melanchthons Gesundheit zunehmend.
1560 erkältete er sich und erkrankte am bösartigen Wechselfieber.
Am 11 April hielt er im großen Hörsaal des Augustinerklosters seine letzte öffentliche Ansprache. Am 19. April 1560 verstarb der nunmehr 63jährige, der nie Angst vor dem Tode gehabt hatte.
Auf seinem Grabmal in der Wittenberger Schlosskirche steht in lateinischer Sprache geschrieben:
„Hier ruht des höchst verehrungswürdigen Philipp Melanchthon Leib, der im Jahre 1560 den 19. April in dieser Stadt gestorben ist, nachdem er gelebt hat 63 Jahre 2 Monate 2 Tage."
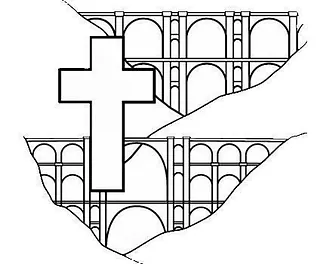

Kommentare